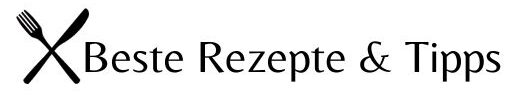In den Gärten unserer Großeltern wuchsen noch Tomatensorten mit Namen wie “Ochsenherz” und “Gelbe vom Neckar”, Bohnen trugen Bezeichnungen wie “Blauhilde” oder “Käferbohne”, und Apfelbäume brachten Früchte hervor, die heute kaum noch jemand kennt. Diese alten Sorten retten Pflanzen vor dem Vergessen ist mehr als nur eine nostalgische Spielerei – es ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur Ernährungssicherheit künftiger Generationen.
Während in Supermärkten heute nur noch wenige Einheitssorten dominieren, verschwinden jährlich hunderte traditioneller Kulturpflanzensorten unwiederbringlich. Mit ihnen gehen nicht nur genetische Ressourcen verloren, sondern auch jahrhundertealtes Wissen, regionale Identität und Geschmacksvielfalt. Doch es gibt eine wachsende Bewegung von Menschen, die sich dem Erhalt dieser kostbaren Pflanzen verschrieben haben – und jeder kann Teil dieser Bewegung werden.
In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie, warum alte Pflanzensorten so wertvoll sind, wie Sie selbst aktiv werden können und welche praktischen Schritte notwendig sind, um diese lebendigen Kulturschätze für kommende Generationen zu bewahren.
Warum sind alte Pflanzensorten so wichtig?
Die Bedeutung alter Kulturpflanzensorten erschließt sich erst, wenn man versteht, was in den letzten Jahrzehnten in der Landwirtschaft und im Gartenbau geschehen ist. Während vor hundert Jahren noch tausende verschiedene Gemüse-, Obst- und Getreidesorten angebaut wurden, hat sich diese Vielfalt dramatisch reduziert. Schätzungen zufolge sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 75 Prozent der Sortenvielfalt verloren gegangen.
Genetische Vielfalt als Lebensversicherung
Alte Sorten retten Pflanzen bedeutet in erster Linie, genetische Vielfalt zu bewahren. Jede Sorte trägt ein einzigartiges Erbgut in sich, das über Generationen durch Auslese und Anpassung an lokale Bedingungen entstanden ist. Diese genetische Diversität ist von unschätzbarem Wert, denn sie bildet das Reservoir, aus dem zukünftige Züchtungen schöpfen können.
In Zeiten des Klimawandels gewinnt dieser Aspekt zusätzliche Brisanz. Alte, regional angepasste Sorten verfügen oft über Eigenschaften, die sie widerstandsfähiger gegen Trockenheit, Hitze oder Schädlinge machen. Sie sind das Ergebnis jahrhundertelanger natürlicher Selektion unter realen Bedingungen – ein Wissen, das sich nicht einfach im Labor nachbilden lässt.
Geschmack und Qualität wiederentdecken
Wer einmal eine alte Tomatensorte wie “Schwarze Krim” oder “Ananas” probiert hat, versteht sofort, warum der Erhalt dieser Sorten so wichtig ist. Moderne Züchtungen wurden oft auf Eigenschaften wie Transportfähigkeit, einheitliches Aussehen und hohen Ertrag optimiert – Geschmack und Aroma blieben dabei häufig auf der Strecke.
Alte Sorten hingegen bestechen durch intensive Aromen, interessante Texturen und eine geschmackliche Vielfalt, die in kommerziellen Sorten kaum noch zu finden ist. Sie erinnern uns daran, wie Gemüse und Obst eigentlich schmecken sollten, und bereichern unsere Küche mit vergessenen Geschmackserlebnissen.
Kulturelles Erbe und regionale Identität
Hinter jeder alten Sorte steckt auch eine Geschichte. Viele Sorten sind untrennbar mit bestimmten Regionen verbunden und Teil der lokalen Identität. Die Allgäuer Emmer, die Bamberger Hörnla oder die Wiener Gemüsesorten sind lebendige Zeugnisse regionaler Kultur und Tradition.
Wenn wir alte Sorten retten Pflanzen bewahren, erhalten wir auch dieses immaterielle Kulturerbe. Wir geben Geschichten weiter, pflegen Traditionen und schaffen eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft. In einer zunehmend globalisierten Welt gewinnt diese regionale Verwurzelung neue Bedeutung.
Welche Pflanzen sind besonders gefährdet?
Nicht alle Kulturpflanzen sind gleichermaßen vom Aussterben bedroht. Besonders kritisch ist die Situation bei Sorten, die kommerziell nicht mehr interessant sind, weil sie beispielsweise unregelmäßig geformt sind, längere Reifezeiten haben oder sich nicht maschinell ernten lassen.
Gemüsesorten mit besonderem Erhaltungsbedarf
Bei Tomaten, Bohnen, Erbsen und Salaten ist die Sortenvielfalt in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen. Während im 19. Jahrhundert allein in Deutschland mehrere tausend Tomatensorten dokumentiert waren, dominieren heute im kommerziellen Anbau weniger als zehn Sorten den Markt.
Besonders gefährdet sind samenfeste Sorten, die durch Hybridzüchtungen verdrängt wurden. Hybride haben zwar oft höhere Erträge, aber ihr Saatgut kann nicht sortenecht weitervermehrt werden – ein Geschäftsmodell, das Landwirte und Gärtner in Abhängigkeit von Saatgutkonzernen bringt.
Alte Kohlsorten, historische Rübensorten und vergessene Wurzelgemüse wie Pastinaken, Haferwurzel oder Schwarzwurzeln verschwinden ebenfalls zunehmend aus den Gärten. Mit ihnen geht nicht nur Vielfalt verloren, sondern auch Wissen über Anbau, Verwendung und Lagerung.
Obstsorten am Rande des Verschwindens
Im Obstbau ist die Situation besonders dramatisch. Von den tausenden Apfelsorten, die früher in Mitteleuropa kultiviert wurden, sind viele nur noch in einzelnen alten Bäumen erhalten. Sorten wie “Schöner von Nordhausen”, “Champagner Renette” oder “Geheimrat Dr. Oldenburg” kennt kaum noch jemand, obwohl sie hervorragende Eigenschaften besitzen.
Ähnlich sieht es bei Birnen, Kirschen und Pflaumen aus. Viele alte Sorten wurden speziell für bestimmte Zwecke gezüchtet – als Most-, Koch- oder Dauerobst – und sind für diese Verwendung modernen Sorten oft überlegen. Ihr Verschwinden bedeutet auch den Verlust dieser spezialisierten Eigenschaften.
Getreide und Feldfrüchte
Auch bei Getreide ist die Vielfalt drastisch geschrumpft. Alte Getreidesorten wie Emmer, Einkorn oder verschiedene Dinkellandsorten wurden durch wenige Hochleistungssorten ersplant. Diese alten Getreidearten enthalten oft andere Glutenstrukturen und werden von manchen Menschen besser vertragen als moderne Weizensorten.
Praktische Wege: Wie Sie alte Sorten retten können
Die gute Nachricht ist: Jeder kann aktiv zum Erhalt alter Pflanzensorten beitragen, unabhängig davon, ob man einen großen Garten, einen kleinen Balkon oder nur eine Fensterbank zur Verfügung hat. Alte Sorten retten Pflanzen ist ein demokratisches Projekt, bei dem viele kleine Beiträge Großes bewirken können.
Samen beziehen und anbauen
Der erste Schritt besteht darin, Saatgut alter Sorten zu beschaffen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es mehrere Organisationen, die sich dem Erhalt alter Sorten verschrieben haben. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), ProSpecieRara in der Schweiz oder ARCHE NOAH in Österreich bieten umfangreiche Samenkataloge mit hunderten historischen Sorten.
Auch kleine, spezialisierte Saatguthändler führen oft alte und seltene Sorten in ihrem Sortiment. Achten Sie beim Kauf darauf, dass es sich um samenfeste Sorten handelt, also keine F1-Hybride, denn nur samenfestes Saatgut kann sortenecht weitervermehrt werden.
Der Anbau selbst unterscheidet sich nicht grundlegend vom Anbau moderner Sorten. Allerdings lohnt es sich, die spezifischen Eigenschaften jeder Sorte kennenzulernen. Manche alte Sorten haben längere Reifezeiten, andere sind besonders robust oder stellen spezielle Ansprüche an Boden und Standort.
Saatgut richtig gewinnen und lagern
Das Herzstück der Sortenerhaltung ist die Saatgutgewinnung. Nur wenn Sie selbst Samen ernten und weitervermehren, tragen Sie aktiv zur Erhaltung bei. Bei Tomaten, Bohnen, Erbsen und Salat ist die Samengewinnung relativ einfach und auch für Anfänger gut durchführbar.
Wichtig ist, dass Sie gesunde, typische Pflanzen für die Samengewinnung auswählen. Achten Sie auf sortentypische Merkmale und wählen Sie mehrere Pflanzen aus, um genetische Verarmung zu vermeiden. Die Samen sollten vollständig ausreifen, bevor Sie sie ernten.
Nach der Ernte müssen die Samen gründlich getrocknet werden. Legen Sie sie an einem warmen, luftigen Ort aus und wenden Sie sie regelmäßig. Erst wenn sie vollständig trocken sind – sie sollten beim Biegen brechen statt sich zu biegen – können sie eingelagert werden.
Die Lagerung erfolgt am besten in Papiertüten oder kleinen Gläsern an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort. Beschriften Sie jede Portion sorgfältig mit Sortenname, Herkunft und Erntejahr. Bei richtiger Lagerung bleiben viele Samen mehrere Jahre keimfähig.
Tauschbörsen und Netzwerke nutzen
Sie müssen nicht allein arbeiten. In vielen Regionen gibt es Saatguttauschbörsen, bei denen Gärtner ihre selbst gewonnenen Samen tauschen und weitergeben. Diese Veranstaltungen sind nicht nur eine hervorragende Quelle für seltenes Saatgut, sondern auch Treffpunkte für Gleichgesinnte und Orte des Wissensaustauschs.
Online-Plattformen und Foren bieten zusätzliche Möglichkeiten der Vernetzung. Viele Erhaltungsinitiativen haben Saatgutbibliotheken eingerichtet, aus denen Mitglieder Samen ausleihen können – mit der Verpflichtung, einen Teil der Ernte als Samen zurückzugeben.
Sortenpatenschaften übernehmen
Für besonders engagierte Sortenretter bieten Organisationen wie ARCHE NOAH oder der VEN Sortenpatenschaften an. Als Sortenpate verpflichten Sie sich, eine bestimmte seltene Sorte über mehrere Jahre anzubauen, zu vermehren und zu dokumentieren.
Diese Patenschaften sind ein wichtiger Baustein der Erhaltungsarbeit, denn sie stellen sicher, dass auch sehr seltene Sorten nicht verloren gehen. Meist erhalten Sie als Pate umfassende Informationen zur Sorte, Unterstützung bei Fragen und die Möglichkeit, sich mit anderen Paten auszutauschen.
Die Dokumentation ist ein wichtiger Teil der Patenschaft. Notieren Sie Besonderheiten beim Anbau, beschreiben Sie Aussehen und Geschmack und machen Sie Fotos. Diese Informationen helfen, das Wissen über die Sorte zu bewahren und weiterzugeben.
Rechtliche Aspekte und Sortenzulassung
Ein Aspekt, der oft Verwirrung stifft, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. In der EU darf Saatgut kommerziell nur dann verkauft werden, wenn die Sorte im offiziellen Sortenkatalog eingetragen ist – ein kostspieliges Verfahren, das sich für alte Sorten meist nicht lohnt.
Für Privatpersonen gilt diese Einschränkung jedoch nicht. Sie dürfen alte Sorten für den Eigenbedarf anbauen, Saatgut tauschen und verschenken. Auch der Verkauf kleiner Mengen auf Märkten oder direkt ab Hof ist unter bestimmten Bedingungen möglich.
Erhaltungsorganisationen haben zudem erkämpft, dass alte Sorten als “Erhaltungssorten” mit vereinfachten Anforderungen zugelassen werden können. Dies hat die Weitergabe und den Erhalt erheblich erleichtert.
Die Rolle von Saatgutbanken und Genbanken
Neben der Erhaltung in Gärten und auf Feldern – der sogenannten In-situ-Erhaltung – spielen auch Saatgutbanken eine wichtige Rolle. In diesen Einrichtungen werden Samen unter kontrollierten Bedingungen tiefgefroren und können so über Jahrzehnte gelagert werden.
Die größte Saatgutbank der Welt, der “Svalbard Global Seed Vault” in Norwegen, dient als Backup für den Fall globaler Katastrophen. Auch in Deutschland gibt es mehrere Genbanken, die sich der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen widmen.
Diese Ex-situ-Erhaltung ist wichtig, aber sie hat auch Grenzen. Pflanzen, die nur in Kühlschränken lagern, entwickeln sich nicht weiter und passen sich nicht an veränderte Umweltbedingungen an. Deshalb ist die lebendige Erhaltung durch Anbau so wichtig – alte Sorten retten Pflanzen bedeutet, sie lebendig zu halten, nicht einzufrieren.
Alte Sorten in der Küche: Vielfalt neu entdecken
Der Erhalt alter Sorten ist nicht nur Naturschutz, sondern auch kulinarisches Abenteuer. Viele historische Gemüsesorten haben Eigenschaften, die in der modernen Küche völlig neu sind. Bunte Kartoffeln, mehrfarbige Karotten oder tomatenartige Auberginen bringen nicht nur optische Vielfalt auf den Teller.
Manche alten Sorten eignen sich besonders für bestimmte Zubereitungsarten. So gibt es Bohnen, die sich hervorragend zum Einlegen eignen, Tomaten, die speziell zum Einkochen gezüchtet wurden, oder Kohlsorten, die erst nach dem ersten Frost ihr volles Aroma entwickeln.
Indem Sie alte Sorten in Ihrer Küche verwenden, schließen Sie den Kreis. Sie geben den Pflanzen einen Zweck, entdecken neue Geschmackswelten und können Familie und Freunde an dieser Vielfalt teilhaben lassen. Oft sind es diese Geschmackserlebnisse, die Menschen für den Erhalt begeistern.
Herausforderungen und wie man sie meistert
Der Weg zum erfolgreichen Sortenretter ist nicht immer einfach. Alte Sorten können anfälliger für Krankheiten sein als moderne Züchtungen, die gezielt auf Resistenzen selektiert wurden. Auch die Erträge sind manchmal geringer, und nicht jede Sorte gedeiht an jedem Standort.
Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Betrachten Sie jeden Anbau als Lernprozess. Dokumentieren Sie Ihre Erfahrungen, tauschen Sie sich mit anderen aus und haben Sie Geduld. Oft braucht es mehrere Versuche, bis man den richtigen Umgang mit einer Sorte gefunden hat.
Beginnen Sie mit robusten, einfach zu kultivierenden Sorten und steigern Sie allmählich den Anspruch. Tomaten, Bohnen und Salate sind ideal für Einsteiger, während Kohl oder Wurzelgemüse etwas mehr Erfahrung erfordern.
Fazit: Jeder Garten zählt
Alte Sorten retten Pflanzen ist keine Aufgabe für Spezialisten, sondern eine Bewegung, die von vielen Menschen getragen wird. Jeder Garten, jeder Balkon, der eine alte Sorte beherbergt, ist ein kleiner Beitrag zur Erhaltung unseres gemeinsamen Erbes.
Die Arbeit mit alten Sorten verbindet uns mit der Geschichte, lehrt uns Achtsamkeit und Geduld und schenkt uns die Freude an echter Vielfalt. Sie ist ein praktischer Beitrag zum Naturschutz und zur Ernährungssouveränität – und sie macht einfach Spaß.
Beginnen Sie noch heute: Besorgen Sie sich Samen einer alten Sorte, säen Sie sie aus und werden Sie Teil einer wachsenden Gemeinschaft von Sortenrettern. Mit jedem Samen, den Sie pflanzen, mit jeder Frucht, die Sie ernten, und mit jedem Samen, den Sie weitergeben, tragen Sie dazu bei, dass diese wertvollen Pflanzen auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Die Vielfalt unserer Kulturpflanzen liegt nicht in fernen Genbanken, sondern in unseren Händen – in den Gärten und auf den Balkonen von Menschen wie Ihnen.